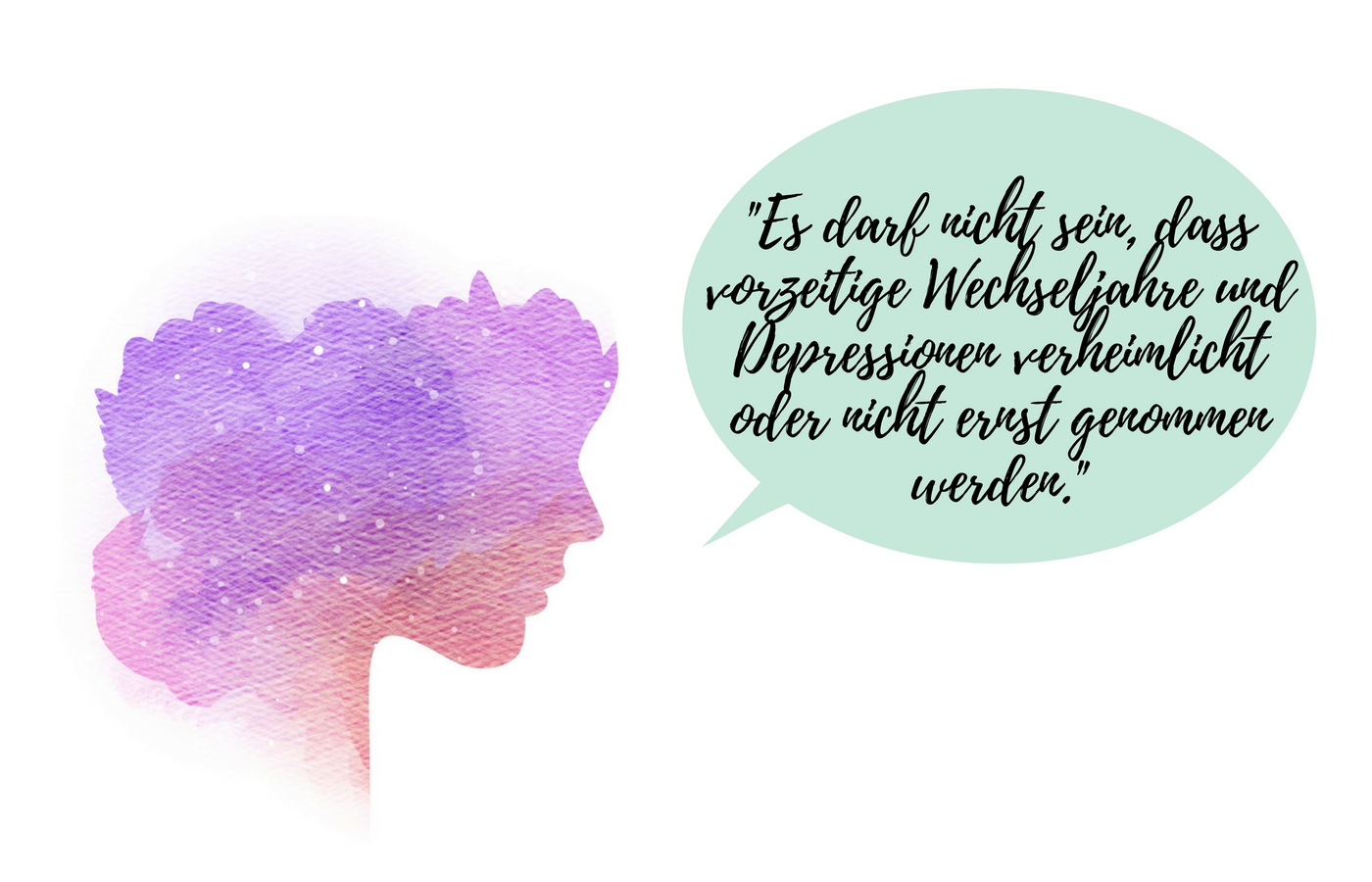
„Es geht mir besser. Nicht gut, aber besser“
Petra* kämpft seit Jahren mit Depressionen. Als die Anti-Depressiva nicht mehr helfen, erfährt sie, dass sie mit ihren 38 Jahren bereits in den Wechseljahren ist. Es folgen Jahre der Ungewissheit und des Kampfs.
Ungewissheit und Beschwerden können zu Suizidgedanken führen
„Ich war körperlich so schwach, schon in den ersten Stock zu gehen kostete mich viel Kraft“, heute geht es Petra etwas besser, doch der Weg dahin, war lang. Noch heute muss sie viele Medikamente nehmen, um ihre Beschwerden auszuhalten. Als Petra 38 Jahre alt war, wirkten die Antidepressiva plötzlich nicht mehr, die sie seit Jahren wegen einer Depression einnehmen musste: „Ich hatte die Depressionen eigentlich im Griff, doch plötzlich hatte ich Panikattacken, Todesängste, Herzrasen, Hitzewallungen, Weinkrämpfe, einen hohen Puls und über zwei Monate lang Blutungen“, schreibt Petra in einer Nachricht „und die Ärzte konnten mir nicht helfen“. Ihre Ängste gingen so weit, dass sie sich mehrmals in eine Psychiatrie einweisen lassen musste und schließlich als therapieressistent entlassen wurde: „In dieser Zeit habe ich oft überlegt mich umzubringen, weil ich nicht mehr weiter wusste“.
Diagnose vorzeitige Wechseljahre
Doch sie wollte nicht Aufgeben. Durch ihre Beschwerden vermutete sie, dass sie bereits in den Wechseljahren war und vereinbarte einen Termin bei ihrer Frauenärztin. Ihre Annahme bestätigte sich. Sie litt an einem starken Progesteronmangel im Zusammenhang mit den frühen Wechseljahren. Ein Mittel gegen ihre starken Beschwerden bekam sie allerdings nicht. Ihre Frauenärztin empfand eine Hormontherapie als „zu gefährlich, wegen Thrombosegefahr und so weiter“. Petra musste also weiter aushalten, mit ihren Ängsten, ihrer Panik und ihren Depressionen selbst auskommen. Irgendwann hielt sie es nicht mehr aus und suchte erneut ihre Gynäkologin auf: „Ich war verzweifelt und sagte ihr, dass ich keine Lebensqualität mehr habe, daraufhin gab sie mir was, es wurde etwas besser aber es war immer noch nicht gut“. Auch eine Gesprächstherapie konnte ihr nicht helfen.
Private Schwierigkeiten machten die Zeit fast unerträglich
In dieser schweren Zeit hätte sie vor allem ihre Mutter gebraucht, doch die brauchte selbst viel Aufmerksamkeit: „Sie konnte mich nicht verstehen, das habe ich ihr nie übel genommen. Sie machte mir Vorwürfe, weil ich mich nicht meldete und verlangte von mir, dass ich mich um ihre Sorgen und Bedürfnisse kümmere. Aber das konnte ich in meiner eigenen Situation einfach nicht.“
Erst vier Jahre später nahte Hilfe
Vier Jahre lang konsultierte sie drei verschiedene Ärzte auf den Verdacht hin, dass etwas mit ihrer Schilddrüse nicht stimmte. Alle drei Ärzte sagten ihr, dass die Werte in der Norm sind und sie deshalb keine Behandlung brauche: „In der Norm heißt aber nicht, dass die Schilddrüsenhormone ausreichen. Bei manchen reicht es, bei manchen nicht“. Erst ihr Psychiater kam schließlich darauf, woher ihre starken Beschwerden wirklich rührten: „Er stellte fest, dass ich doch eine Schilddrüsenunterfunktion habe“. Eine Diagnose, die eigentlich der Frauenarzt hätte stellen müssen. Schon damals, als die vorzeitigen Wechseljahre diagnostiziert wurden, denn nicht selten hängen diese beiden Diagnosen zusammen. „Mir hätte früher geholfen werden können, denn seit ich auf die Empfehlung meines Psychiaters hin hoch dosiert Schilddrüsenmedikamente nehme, geht es mir besser. Ich habe mehr Antrieb“. Er war der vierte Arzt, den sie konsultierte und der einzige, der diese Form von Behandlung befürwortete.
Eine Zeit des Lernens

Mittlerweile ist sie in psychiatrischer Behandlung und muss neben den Schilddrüsenmedikamenten und den Hormonen auch sehr hohe Dosen Antidepressiva nehmen, um es einigermaßen auszuhalten. Mit ihrer Mutter hat Petra den Kontaktabgebrochen: „Ich konnte mit diesen Vorwürfen nicht mehr umgehen. Viele werden mich dafür verurteilen. Sie ist ja meine Mutter, die mich groß gezogen hat aber seit dieser schlimmen Zeit habe ich gelernt, das aus meinem Leben zu streichen, was mich runter zieht und sie ist leider einer dieser Menschen.“
Man muss kämpfen
Aber was sie vor allem aus dieser Zeit mitgenommen hat ist, dass es sich lohnt, zu kämpfen: „Man kann in sieben Minuten keine Diagnose stellen, das ist nicht möglich. Deshalb rate ich allen Frauen, denen es so schlecht geht wie mir, sich von Ärzten nicht abspeisen zu lassen, nichts unversucht zu lassen und sich mehrere Meinungen einzuholen“. Und das auch, wenn man sich in dieser Zeit oft wie ein Versuchskaninchen fühlt: „Wenn wieder ein Medikament nicht wirkt, man wieder enttäuscht ist und denkt niemand kann einem helfen, dann geht das an die Substanz aber irgendwie hält man das aus.“ Woher sie die Kraft hatte, weiß sie nicht, aber es geht ihr besser: „Nicht gut, aber besser“.
*Der Name wurde geändert, um die Privatsphäre zu schützen
